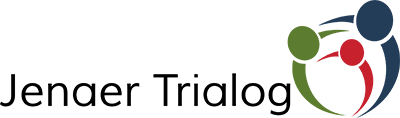Was hier als Thema vielleicht ein wenig „abgenutzt“ daher kommt, weil in den öffentlichen Medien gern bemüht, hatte seinen Ursprung gelöst von den großen Fragen:
Wie viel Wahn braucht es zur Kreativität oder gedeiht Kreativität nur in einem „gesunden“ Geist? Es entsprang dem Dialog zwischen Mutter und Tochter während der Themensammlung, auf die Frage, wie Angehörige und Betroffene die Grenze zwischen Produktivität und „Entgleisung“ definieren würden. Insbesondere Angehörige fürchten diese Phasen, deren Ausgang nicht absehbar ist. Die Lehrmeinungen dazu sind klar definiert. Bei schizophrener Ersterkrankung nach Abklingen mindestens 1 Jahr Fortführung der medikamentösen Behandlung. Bei einer Zweiterkrankung eine Rezidivprophylaxe für zwei bis fünf Jahre und je nach Schwere und Häufigkeit eine lebenslange medikamentöse Versorgung. Der kontinuierlichen Behandlung wird der intermittierenden Behandlung gegenüber grundsätzlich der Vorrang eingeräumt. Weiter betrachtet bedeutet dies, bei jeder Milderung der Symptome, die eine medikamentöse Intervention mit sich bringen mag, auch in angespannter Erwartung zu leben, ob das nun noch Kreativität ist oder schon Wahn, ob es ganz wesenseigene Züge sind, die keinerlei pathologischen Hintergrund haben, oder ob es die Vorboten eines weiteren Schubes sind, der, wie von einer Mutter befürchtet, das Initial für eine lebenslange Medikation bedeutet und das Urteil, dass der „Point of no return“ erreicht ist. Der Begriff „Achtsamkeit“ fällt, achtsam sein im Tag, in dem was ich tue, wie ich es tue, was um mich herum geschieht und was in mir geschieht. „Es hilft mir mich zu organisieren“, so eine Betroffene,“ meinen Tag in eine Form zu bringen, die ich meistern kann, ohne mich zu übernehmen“. Sie erfährt Zuspruch darin. Doch was ist mit den Phasen der Hoch- und Höchstleistung, der Kreativität? Braucht es nicht auch Zeiten in denen ich das Potential mehrerer Monate in wenigen Tagen verschieße? Ist es nicht eintönig jeden Tag dosiert zu leben? Es ist wohl die Frage welchen Preis ich bereit bin dafür zu zahlen. Bin ich Sklave meiner Selbstbeobachtung oder lebe ich als gäbe es kein Morgen? Oder finde ich einen Weg, der irgendwo dazwischen liegt, auf mich und meine Situation angepasst? „Ich saß dann beim Frühstück in der Klinik und schaute in die Kaffeetasse und mir erschloss sich unser Universum. Plötzlich war mir alles klar“, so eine junge Frau. Und dann sagt sie: „Wenn der Kreis derer, die mich verstehen, immer kleiner wird und am Ende niemand mehr übrig bleibt, mit dem ich meine Ideen teilen kann, dann weiß ich, hier ist etwas nicht in Ordnung.“ Es ist eben eine Gratwanderung, wie ein Boot auf dem Fluss der Normalität dessen Kapitän ich bin. Ich bewege mich zwar mal in dieser oder jener Ufernähe, aber ich bin angehalten nicht zu stranden, so ein junger Mann. Vielleicht ist dieser Grat auch keiner in schwindelerregender Höhe, sondern einer auf der gleichen Ebene wie die restliche Umgebung. Auf der einen Seite die „Normalität“ und auf der anderen Seite der „Wahnsinn“. Irgendwo auf dem Grat liegt die Kreativität. Doch was ist mit der Sorge der Angehörigen, zählt diese hinein in den Prozess der Euphorie, der Agilität, der Kreativität? Es scheint ein abgeschotteter Verlauf derer zu sein, die davon betroffen sind, eine Explosion der Sinne, ein reißender Fluss, eine Kettenreaktion, die sich den meisten Zugriffen verweigert. Es scheint eine Energie zu geben, die nicht einfach zu unterdrücken ist. Vielmehr braucht es einen Raum, einen Rahmen diese „Kreativität“ auszuleben. So kann ich den anderen nicht (immer) am Springen hindern. Ich kann aber dafür sorgen, dass er weich landet.
Hagen Eisenhardt